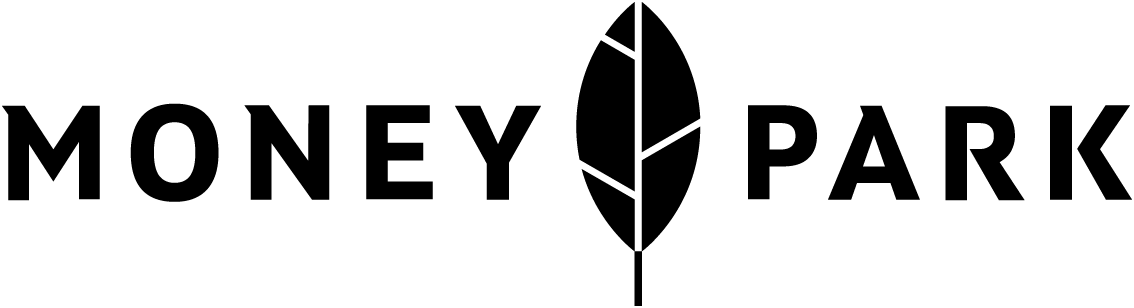Wir nutzen Cookies, um die Website benutzerfreundlich, sicher und effektiv zu gestalten. Cookies dienen der Erhebung von Informationen über die Nutzung von Websites. Weitere Informationen: Hinweise zum Datenschutz

Eigenmietwert einfach erklärt
Was ist der Eigenmietwert?
Der Eigenmietwert ist ein Schweizer Steuermechanismus, der steuerliche Nachteile der Mieterschaft gegenüber Immobilienbesitzenden ausgleichen soll. Denn Eigentümerinnen und Eigentümer können Ihre Unterhaltskosten für die Immobilie sowie ihre Schuldzinszahlungen bei den Steuern abziehen. Im Gegenzug müssen sie fiktive Mieteinnahmen versteuern. Im europäischen Umfeld ist eine solche Steuer die absolute Ausnahme und bot in der Schweiz immer wieder Anlass zu politischen Diskussionen. 1999, 2004 und 2012 wurde die Abschaffung des Eigenmietwerts an der Urne abgelehnt. Am 28. September 2025 gelang den bürgerlichen Parteien zusammen mit dem Eigentümer- und dem Gewerbeverband schliesslich der Erfolg. Der Eigenmietwert wird abgeschafft und an seine Stelle tritt eine neue kantonale Objektsteuer auf Zweitliegenschaften. Bis es so weit ist, dürfte es mindestens Anfang 2028 werden.
Wie wird der Eigenmietwert berechnet?
Der Eigenmietwert wird in der Schweiz von den kantonalen Steuerbehörden festgelegt und orientiert sich am Marktmietwert ähnlicher Immobilien. Meist liegt er bei 60-70% der ortsüblichen Miete. Faktoren wie Lage, Grösse, Ausstattung und Baujahr beeinflussen die Höhe. Jeder Kanton hat eigene Berechnungsmodelle – teils mit Pauschalen, teils mit detaillierten Bewertungsverfahren. Eine individuelle Schätzung durch das Steueramt ist möglich, vor allem bei Änderungen wie Umbauten
Beispiel Eigenmietwert berechnen
Was bedeutet die Abschaffung des Eigenmietwerts für Immobilienbesitzende?
Bei der jährlichen Steuererhebung fallen Eigenmietwert, Hypothekarzins- und Unterhaltskostenabzug fürs Eigenheim weg – dies sowohl auf bundes- als auch auf kantonaler Ebene. Kantone können weiterhin Abzüge für energiesparende und umweltschonende Massnahmen gewähren und für Besitzerinnen und Besitzer von Zweitliegenschaften eine neue Objektsteuer erheben.
Ausnahmen:
- Ersterwerberinnen und Ersterwerber können Schuldzinsen bis max. CHF 10'000 für Ehepaare bzw. CHF 5'000 für Alleinstehende steuerlich in Abzug bringen. Dies linear abnehmend über zehn Jahre nach Kauf von selbstbewohntem Wohneigentum.
- Besitzerinnen und Besitzer von Renditeimmobilien dürfen einen Teil der Schuldzinsen für die Renditeimmobilie weiterhin abziehen. Die Höhe des zulässigen Abzugs entspricht dem Anteil des nicht selbstbewohnten Immobilienvermögens am Gesamtvermögen.
Wer profitiert und für wen könnte es teurer werden?
Aktuell ist der Eigenmietwert in vielen Kantonen sehr tief angesetzt, so dass er sich mit dem Hypothekarzinsabzug und jährlichen Unterhaltskosten in vielen Fällen aufwiegen lässt. «Schmerzen» verursacht er insbesondere dort, wo nicht in die Immobilie investiert wird und deshalb kaum Steuerabzüge möglich sind. Generell lässt sich deshalb sagen, dass Haushalte mit kleinen Hypothekarvolumen und tiefen Hypothekarzinsen sowie geringen Investitionsabzügen zukünftig weniger Steuern bezahlen dürften. Sie können aktuell den Eigenmietwert nicht vollständig kompensieren. Tendenziell teurer wird es für Haushalte mit grossen Hypothekarvolumen, hohen Hypothekarzinsen und vielen anstehenden Renovationen. Sie können heute den Eigenmietwert "überkompensieren", was nach der Abschaffung nicht mehr möglich ist.
Haushalte mit kleinem Hypothekarvolumen und tiefen Hypothekarzinsen
Haushalte mit geringen Investitionsabzügen
Neukäuferinnen und -käufer, für welche ein Ersterwerberabzug vorgesehen ist
Haushalte mit grossen Hypothekarvolumen und hohen Hypothekarzinsen
Besitzerinnen und Besitzer von älteren Liegenschaften mit viel Renovationsbedarf
Immobilienbesitzende mit mehreren Wohneinheiten, welche vermietet werden
Welche negativen Auswirkungen hat die Abschaffung des Eigenmietwerts?
Die Abschaffung des Eigenmietwerts wird je nach Zinsniveau zu erheblichen Steuerausfällen bei Bund und Kantonen führen. Zudem entfällt der Unterhaltsabzug, was Sanierungen unattraktiver macht. Auch am Hypothekarmarkt dürfte der Systemwechsel nicht spurlos vorbeigehen. Aufgrund der vorliegenden Daten geht MoneyPark davon aus, dass innert fünf Jahren nach Abschaffung des Eigenmietwerts Gelder in der Grössenordnung von 50 bis 150 Mia. zurückfliessen dürften. Das obere Ende dieser Spannbreite würde bedeuten, dass der Schweizer Hypothekarmarkt, welcher in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich rund CHF 30 Mia. pro Jahr von rund CHF 900 Mrd. auf mittlerweile über CHF 1’200 Mrd. angestiegen ist, nicht mehr weiterwachsen würde. Denn mit der Abschaffung des Eigenmietwerts dürfte ziemlich genau diese Summe pro Jahr an Amortisationen zurückfliessen.